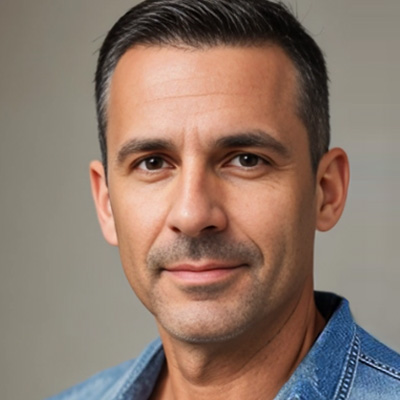Frankfurt am Main – Hinter der glitzernden Skyline und den Hochhäusern der Bankenmetropole findet ein stiller Krieg gegen den illegalen Fahrdienstmarkt statt. Steuerbetrug, ungeklärter Versicherungsschutz und ein unfairer Wettbewerb für legale Anbieter. Doch Frankfurt wehrt sich mit verstärkten Kontrollen und einem neuartigen Datenabgleich, mit denen die Fahrdienst-Apps gegen den Zuwachs an illegalen Fahrten vorgehen wollen.

Illegale Fahrdienste in Frankfurt verursachen Schäden und Sicherheitsrisiken. Die Stadt reagiert mit einer neuen Strategie aus verstärkten Kontrollen und der Methodik des Datenabgleichs.
- Steuerbetrug und Sozialabgabenbetrug durch illegale Fahrdienste belasten die Frankfurter Stadtkasse.
- Gefälschte Zulassungen und unseriöse Versicherungen gefährden Fahrgäste und führen zu Wettbewerbsverzerrungen für legale Anbieter.
- Neue Strategie setzt auf Kooperation mit den Fahrtenvermittlungs-Apps und einen automatisierten Datenabgleich.
Das Ausmaß des Problems: Eine Bilanz
Die genauen Zahlen sind schwer zu benennen, doch die Dunkelziffer scheint hoch zu sein. Experten schätzen, dass ein großer Anteil, der in Frankfurt über Fahrdienst-Apps vermittelten Fahrten illegal durchgeführt wird. Der Steuerschaden für die Stadtkasse geht dabei in die Millionen, denn viele Fahrer zahlen weder Steuern noch Sozialabgaben.
Für die Fahrgäste birgt all das ein großes Risiko, denn fehlt der Versicherungsschutz, drohen im Schadensfall hohe Kosten. Und auch die Sicherheit ist nicht gewährleistet, da die Qualifikation der Fahrer oftmals nicht geprüft ist. Um sich zu schützen, sollten Fahrgäste folgende Punkte beachten:
- Zulassung checken: Ein Blick auf die Zulassung des Fahrers – online beim Verkehrsbetrieb oder direkt beim Fahrer.
- App-Bewertungen prüfen: Viele negative Bewertungen in der App sollten skeptisch machen.
- Bargeld vermeiden: Kreditkarte oder Bezahlung über die App sind sicherer als Bargeld.
- Daten abgleichen: Kennzeichen und App-Daten müssen übereinstimmen. Unterschiedlichkeiten sind ein Warnsignal.
- Lieber verzichten: Bei Unsicherheiten sollte man die Fahrt lieber abbrechen.
- Vorfälle melden: Verdächtige Aktivitäten gehören gemeldet – beim Verkehrsbetrieb oder der Polizei.
- Regelmäßig informieren: Webseiten wie Presseportal der Polizei berichten regelmäßig über solche oder ähnliche Fälle.
Für die legalen Taxiunternehmen und Mietwagenfirmen bedeutet der illegale Wettbewerb einen regelrechten Kahlschlag. Sie kämpfen nicht nur mit den oft niedrigeren Preisen der Schwarzarbeit, sondern auch mit dem ungleichen Wettbewerb, der durch die fehlende Kontrolle entsteht.
Der Fall der gefälschten Lizenzen
Der jüngste Fall von rund hundert gefälschten Mietwagengenehmigungen in Frankfurt, die über Plattformen wie Uber und Bolt illegal Fahrten ermöglichten, ist nur die Spitze des Eisbergs und eher eine moderne Art der Täuschung, ähnlich wie Airbnb Betrug.
In Berlin wurden über 1600 Fahrzeuge ohne Genehmigung über ähnliche Plattformen vermittelt. Solch ein Vorgehen, oft nach dem 80/20-Modell (80% des Fahrpreises für den Fahrer, 20% für den Hintermann), nutzt gefälschte Dokumente, um Fahrzeuge auf den Plattformen freizuschalten.
Zusätzlich sparen die Kriminellen durch falsche Versicherungen (private PKW statt Mietwagenversicherung) erheblich Kosten, was hohe Risiken für Fahrgäste im Schadensfall bedeutet. Scheinfirmen und Strohleute helfen dabei, Steuerzahlungen zu umgehen und Firmen nach kurzer Zeit wieder zu verkaufen oder in die Insolvenz zu treiben. In Frankfurt belief sich der wirtschaftliche Schaden auf rund 2,5 Millionen Euro, verursacht durch ausbleibende Lohn- und Umsatzsteuer sowie fehlende Sozialversicherung der Fahrer.
Im Gegensatz zum klassischen Online Betrug, bei dem meist einzelne Opfer direkt über das Internet kontaktiert werden, sind hier potenziell viele Personen in Mitleidenschaft gezogen: nicht nur die Stadt, die Einnahmen verliert, sondern auch legale Taxifahrer, die unter dem unfairen Wettbewerb leiden, und die Fahrgäste, die ohne Versicherungsschutz fahren. Doch wie sehen nun konkrete Gegenmaßnahmen aus?
Die neue Strategie: Datenabgleich mit dem Ordnungsamt
Frankfurt setzt auf eine neue Strategie, um den illegalen Fahrdiensten den Garaus zu machen: Kooperation statt Konfrontation. Das Ordnungsamt arbeitet nun eng mit den großen Ride-Hailing-Plattformen wie Uber, Bolt und FreeNow zusammen. Kernstück der Strategie ist ein umfassender Datenabgleich: Die Plattformen verpflichten sich, die Daten ihrer Fahrer regelmäßig mit der Datenbank des Ordnungsamtes abzugleichen.
So soll sichergestellt werden, dass nur zugelassene Fahrzeuge und Fahrer auf den Plattformen aktiv sind. Die Funktionsweise ist denkbar einfach: Jeder neue Fahrer muss seine Zulassung nachweisen. Ein automatisierter Abgleich prüft die Daten in Echtzeit. Fehlt die Zulassung, wird der Fahrer von der Plattform gesperrt. Das Ordnungsamt seinerseits verstärkt die Kontrollen im Stadtgebiet.
Wer ohne gültige Erlaubnis fährt, der muss mit empfindlichen Strafen rechnen. Die Zusammenarbeit mit Uber, Bolt und Co. ist dabei zentral: Die Apps sollen künftig illegale Aktivitäten frühzeitig erkennen und melden. Die Stadt setzt nicht nur auf Strafen, sondern auch auf Prävention. Ein neuer technischer Datenabgleich soll illegale Fahrer schneller identifizieren. Das Ordnungsamt kontrolliert das System, die Apps liefern die technischen Daten. Diese Kooperation ist ein wichtiger Schritt zur Regulierung des Marktes.
Die Verantwortung der Plattformen
Die Verantwortung der Apps wie Uber, Bolt und FreeNow wird noch diskutiert. Kritiker beschuldigen sie, die illegalen Fahrten durch ihr Geschäftsmodell erst zu ermöglichen. Die Firmen selbst betonen ihre Rolle als reine Vermittler und weisen die Verantwortung für die Überprüfung der Fahrer-Zulassung von sich. Höhere Mindestpreise stehen zwar zur Debatte, würden das Problem allerdings nur teilweise lösen.
Das würde außerdem einkommensschwache Fahrgäste benachteiligen. Hinzu kommt, dass die illegale Konkurrenz die Löhne der legalen Fahrer drückt und die staatliche Kontrolle untergräbt. Die Rechtslage ist also noch ziemlich unklar und die Haftung der Apps für das Handeln ihrer Fahrer ist noch nicht geklärt. Frankfurts neue Strategie macht aber deutlich, dass die Kooperation zwischen der Stadt und den Anbietern bei der Bekämpfung des Problems helfen kann; andernfalls drohen Sanktionen.
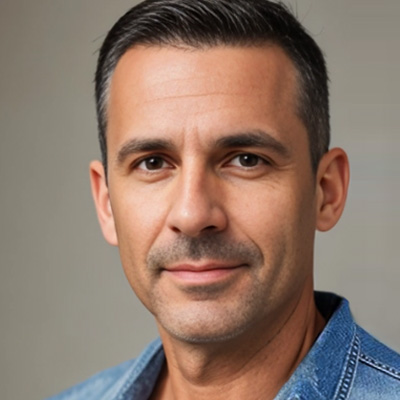 Geschrieben von:
Geschrieben von: